Gebet – das Kennzeichen eines Christen
Römer 8, 15
Predigt Andreas Symank
Freie Evangelische Gemeinde Zürich
Helvetiaplatz
Zürich, 18. April 2004
Die Heilung der
zehn Aussätzigen und der Dank des Samaritaners
Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus
durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen; sie
blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: „Jesus, Meister, hab
Erbarmen mit uns!“ Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: „Geht und zeigt euch
den Priestern!“ Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund.
Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass
er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen
nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: „Sind
denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem
außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu
geben?“ Dann sagte er zu dem Mann: „Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat
dich gerettet.“
Lukas
17,11-19
Woran erkennt man einen Christen? Was meinen Sie? Was charakterisiert jemand, der zu Jesus gehört? Wenn Sie nur ein einziges Merkmal angeben dürften – welches würden Sie angeben? Erkennt man einen Christen daran, dass er sonntags die Kirchenbank drückt (wir haben hier gar keine Kirchenbänke)? Erkennt man ihn daran, dass er im Gemeindechor mitsingt (wir haben zur Zeit gar keinen Chor)? Erkennt man ihn daran, dass er in der Bibel liest? Daran, dass er nicht die Ehe bricht? Daran, dass er aufrichtig und vertrauenswürdig ist? Ich würde sagen: Man erkennt ihn daran, dass er betet. Gebet ist das Kennzeichen echten Christseins. Gottesdienstbesuch und Bibellesen sind extrem wichtig – aber trotzdem: Das tut manchmal auch ein Skeptiker oder ein Suchender. Ein Leben nach Gottes Geboten ist unerlässlich – aber auch mancher Gottlose lässt sich nichts zuschulden kommen. Dagegen Beten: Das weist auf eine persönliche Beziehung zu Gott hin. Da hat jemand sein Innerstes für Gott geöffnet und hat das Gespräch mit ihm aufgenommen. Wie entscheidend wichtig dieses Kennzeichen ist, sieht man gerade an meinem Berufsstand. Wenn irgend jemand sich für Gott interessiert, sind das doch die Theologen, die „Gottesgelehrten“. Wenn also irgend jemand das Gespräch mit Gott sucht, müssten das die Theologen sein. Aber es gibt – leider! – zahllose Theologen, denen fehlt diese persönliche Beziehung zu Gott. Sie finden Gott hochinteressant – als Forschungsgegenstand. Sie schreiben gelehrte Abhandlungen über ihn, sie halten gelehrte Vorträge über ihn – aber eben, immer nur über ihn. Mit Gott reden, zu ihm beten – das tun sie nicht; das können und wollen sie nicht. Gott ist für sie ein Er, nicht ein Du.
Über das Gebet als Kennzeichen von echtem Christsein habe ich ein paar Punkte zusammengetragen, die ich an Sie weitergeben möchte.
Das Gebet und der Heilige Geist
Es gibt zum Gebet einen Vers im Römerbrief, der ist ganz große Klasse – Römer 8,15. Zum besseren Verständnis lese ich den vorangehenden Vers mit dazu:
„Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: ‚Abba, Vater!’ “
Was steht hier in Sachen Gebet? „Durch ihn (den Geist Gottes) rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater!“ Beten hat demnach mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist bringt uns dazu, dass wir beten. Dieser Zusammenhang ist grundlegend wichtig; er erklärt, wieso Beten tatsächlich das Kennzeichen eines Christen ist.
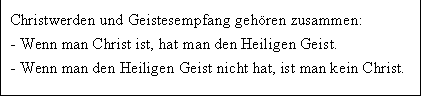 Römer 8 ist ja das große Kapitel vom Heiligen
Geist. Paulus sagt in Vers 9: „Gottes Geist wohnt in uns“ (gemeint ist
natürlich: in denen, die zu Jesus Christus gehören, in den Christen). Er wohnt
in uns: Wir können das ruhig mal ganz wörtlich nehmen. Da ist also eines Tages
ein Möbelwagen vorgefahren, da hat jemand bei uns Einzug gehalten. Wann war
das? Das war an dem Tag, als wir unser Leben Jesus öffneten, bei unserer Umkehr
zu ihm. Es gibt heute nicht wenige Christen, die meinen, der Heilige Geist
ziehe erst später ins Leben ein, im Rahmen einer Geistestaufe, am besten in
Verbindung mit einem so außergewöhnlichen Erlebnis wie dem Reden in unverständlichen
Sprachen. Paulus teilt diese Ansicht nicht. Christwerden und Geistesempfang
gehören für ihn untrennbar zusammen. In Vers 9 schreibt er: "Wenn jemand
diesen Geist nicht hat, gehört er nicht zu Christus", und in Vers 10:
"Wenn Christus in euch ist, dann habt ihr den Geist empfangen". Mit
anderen Worten: Wenn man Christ ist, hat man den Heiligen Geist; wenn man den Heiligen
Geist nicht hat, ist man kein Christ. Der Besitz des Heiligen Geistes ist nicht
das Prärogativ einer bestimmten Gruppe von Christen, er ist das Kennzeichen
aller, die zur Gemeinde Jesu gehören.
Römer 8 ist ja das große Kapitel vom Heiligen
Geist. Paulus sagt in Vers 9: „Gottes Geist wohnt in uns“ (gemeint ist
natürlich: in denen, die zu Jesus Christus gehören, in den Christen). Er wohnt
in uns: Wir können das ruhig mal ganz wörtlich nehmen. Da ist also eines Tages
ein Möbelwagen vorgefahren, da hat jemand bei uns Einzug gehalten. Wann war
das? Das war an dem Tag, als wir unser Leben Jesus öffneten, bei unserer Umkehr
zu ihm. Es gibt heute nicht wenige Christen, die meinen, der Heilige Geist
ziehe erst später ins Leben ein, im Rahmen einer Geistestaufe, am besten in
Verbindung mit einem so außergewöhnlichen Erlebnis wie dem Reden in unverständlichen
Sprachen. Paulus teilt diese Ansicht nicht. Christwerden und Geistesempfang
gehören für ihn untrennbar zusammen. In Vers 9 schreibt er: "Wenn jemand
diesen Geist nicht hat, gehört er nicht zu Christus", und in Vers 10:
"Wenn Christus in euch ist, dann habt ihr den Geist empfangen". Mit
anderen Worten: Wenn man Christ ist, hat man den Heiligen Geist; wenn man den Heiligen
Geist nicht hat, ist man kein Christ. Der Besitz des Heiligen Geistes ist nicht
das Prärogativ einer bestimmten Gruppe von Christen, er ist das Kennzeichen
aller, die zur Gemeinde Jesu gehören.
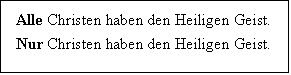 Gleichzeitig muss aber auch betont werden: Er
ist ausschließlich das Kennzeichen derer, die zur Gemeinde Jesu gehören.
Viele wollen heute Erfahrungen mit dem Heiligem Geist machen, ohne sich Jesus
zu unterstellen. Christsein ist out, aber spirituelle Frömmigkeit ist in. Nur:
Da macht Gott nicht mit. Den Heiligen Geist gibt es nur über Jesus, nicht an
Jesus vorbei. Der Heilige Geist ist kein zweites Erlösungsmittel, kein vom
Kreuz unabhängiger Weg zu Gott.
Gleichzeitig muss aber auch betont werden: Er
ist ausschließlich das Kennzeichen derer, die zur Gemeinde Jesu gehören.
Viele wollen heute Erfahrungen mit dem Heiligem Geist machen, ohne sich Jesus
zu unterstellen. Christsein ist out, aber spirituelle Frömmigkeit ist in. Nur:
Da macht Gott nicht mit. Den Heiligen Geist gibt es nur über Jesus, nicht an
Jesus vorbei. Der Heilige Geist ist kein zweites Erlösungsmittel, kein vom
Kreuz unabhängiger Weg zu Gott.
Der Heilige Geist ist also nun bei uns eingezogen – aber wohlgemerkt: nicht als Gast, sondern als neuer Hausherr. Wenn Gott im Leben eines Menschen Einzug hält, dann immer nur als Herr, nie als Dienstbote. Er gehört nicht ins Gästezimmer, sondern in den Wohnraum. Ein Gast rümpft vielleicht die Nase über die Bilder, die wir an der Wand hängen haben, und äußert sich abfällig über die Farbe unserer Tapeten. Aber das ist auch alles; verändern darf er nichts. Wie es bei uns aussieht, bestimmen wir, die Gastgeber. Anders ist es, wenn wir diesen neuen Bewohner bewusst bitten, Hausherr zu werden: Dann bestimmt er, wie es bei uns aussieht. Dann kommen seine Möbel nicht ins Kellerabteil, sondern in die Wohnung; dann sagt er, welches Buch und welche Zeitschrift eigentlich nicht in unser Haus gehören und was vielleicht statt dessen angeschafft werden sollte; dann bestimmt er über mögliche Gäste und Gesprächsinhalte. Kurz gesagt: Den Tapetenwechsel vollzieht er.
Was bringt denn nun dieser neue Bewohner mit? Was tragen die Möbelpacker in mein Haus, wenn ich mich entschließe, mein Leben Jesus Christus anzuvertrauen? Eine ganze Menge (nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ):
- Leben (V. 6 und 10)
- Frieden (V. 6)
- Kraft (V. 11)
- Freiheit (V. 15)
- Gewissheit (V. 16)
- Hoffnung (V. 17)
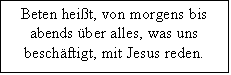 Aber dann bringt der Heilige Geist uns noch
etwas in Haus: die Bereitschaft zum Gebet; das Verlangen zu beten; die Freude
am Gebet. Vers 15: „Durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater!“ Auch
Nichtchristen beten ja hin und wieder zum lieben Gott – vor allem unter Druck,
in Verzweiflung, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen. Aber das ist eigentlich nur
so etwas wie ein Notschrei, herausgeschleudert aus einem Kessel, der zu sehr
unter Druck steht; das Gebet ist wie ein Ventil, wo sich der Druck einen Ausweg
schafft. Aber wenn dann der Druck nachlässt, ist es mit dem Gebet vorbei – aus
und vergessen. Regelmäßiges Beten als ein Herzensbedürfnis (um einmal dieses altmodische
Wort zu gebrauchen) kennt der Nichtchrist nicht. Wie sollte er auch? Beten ist
Reden mit Gott, aber wie soll man mit jemand reden, den man nicht kennt und
nicht mag? Wieso soll man das Gespräch mit jemand suchen, von dem man nichts
wissen will? Und umgekehrt: Dass ein Christ mit Gott redet, ist
selbstverständlich. Ein Kind hat seinen Eltern gegenüber ein natürliches
Mitteilungsbedürfnis. Wenn es von einem Schulausflug nach Hause kommt und nicht
erst einmal erzählt, wie es war, sondern sich schnurstracks in sein Zimmer
verzieht, stimmt irgend etwas nicht. Wenn ein Mensch Christ wird, entsteht in
ihm mit einemmal der Wunsch zu beten. Er beginnt eine Tätigkeit, die er vorher
nie ausgeübt hat. Er beginnt, mit seinem Vater im Himmel über sein Gedanken und
Empfindungen und Taten zu sprechen. Es ist ihm ein Anliegen, ihn dabeizuhaben,
um seinen Rat zu bitten, um seinen Schutz, um seinen Segen. Er bittet ihn um
Vergebung, er dankt und lobt. Gott ist plötzlich bewusst mit einbezogen in
unser Leben. Wo wir etwas tun, was wir nicht mit Gott besprechen können, was
wir lieber vor ihm geheimhalten möchten, da können wir sicher sein, dass es
nichts Gutes ist. Beten heißt, von morgens bis abends über alles, was uns
beschäftigt, mit Jesus zu reden.
Aber dann bringt der Heilige Geist uns noch
etwas in Haus: die Bereitschaft zum Gebet; das Verlangen zu beten; die Freude
am Gebet. Vers 15: „Durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater!“ Auch
Nichtchristen beten ja hin und wieder zum lieben Gott – vor allem unter Druck,
in Verzweiflung, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen. Aber das ist eigentlich nur
so etwas wie ein Notschrei, herausgeschleudert aus einem Kessel, der zu sehr
unter Druck steht; das Gebet ist wie ein Ventil, wo sich der Druck einen Ausweg
schafft. Aber wenn dann der Druck nachlässt, ist es mit dem Gebet vorbei – aus
und vergessen. Regelmäßiges Beten als ein Herzensbedürfnis (um einmal dieses altmodische
Wort zu gebrauchen) kennt der Nichtchrist nicht. Wie sollte er auch? Beten ist
Reden mit Gott, aber wie soll man mit jemand reden, den man nicht kennt und
nicht mag? Wieso soll man das Gespräch mit jemand suchen, von dem man nichts
wissen will? Und umgekehrt: Dass ein Christ mit Gott redet, ist
selbstverständlich. Ein Kind hat seinen Eltern gegenüber ein natürliches
Mitteilungsbedürfnis. Wenn es von einem Schulausflug nach Hause kommt und nicht
erst einmal erzählt, wie es war, sondern sich schnurstracks in sein Zimmer
verzieht, stimmt irgend etwas nicht. Wenn ein Mensch Christ wird, entsteht in
ihm mit einemmal der Wunsch zu beten. Er beginnt eine Tätigkeit, die er vorher
nie ausgeübt hat. Er beginnt, mit seinem Vater im Himmel über sein Gedanken und
Empfindungen und Taten zu sprechen. Es ist ihm ein Anliegen, ihn dabeizuhaben,
um seinen Rat zu bitten, um seinen Schutz, um seinen Segen. Er bittet ihn um
Vergebung, er dankt und lobt. Gott ist plötzlich bewusst mit einbezogen in
unser Leben. Wo wir etwas tun, was wir nicht mit Gott besprechen können, was
wir lieber vor ihm geheimhalten möchten, da können wir sicher sein, dass es
nichts Gutes ist. Beten heißt, von morgens bis abends über alles, was uns
beschäftigt, mit Jesus zu reden.
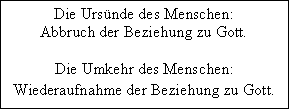 Die erste Hälfte des Römerbriefs ist
gewissermaßen eine Abhandlung über die Heilsgeschichte – eine Abhandlung darüber,
wie wir Menschen einen Graben zwischen uns und Gott aufgerissen haben und wie
Gott über diesen Graben eine Brücke gebaut hat, um die abgebrochene Beziehung
wieder herzustellen. Paulus fängt damit an, dass er von der Schuld des Menschen
spricht, Römer 1 bis 3. Worin bestand die Ursünde? Kap. 1,21: "Trotz
allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die
ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig." Es ist der Bruch des
ersten Gebots: "Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen
Götter neben mir haben!" Es ist der Abbruch der Beziehung mit dem, der
unser Leben gemacht hat und es erhält. Alles andere – der Bruch der übrigen
Gebote, die Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen – folgt dann
daraus. Die Ursünde ist religiös, nicht moralisch. Und worin besteht
folgerichtig eine echte Lebensumkehr? Nicht in moralisch hochstehenden Handlungen,
sondern in der Wiederaufnahme der Beziehung zu Gott, und die zeigt sich eben
nirgends deutlicher als am Gebet. Alles andere – z. B. eine bessere Lebensführung
– wird dann die Frucht davon sein.
Die erste Hälfte des Römerbriefs ist
gewissermaßen eine Abhandlung über die Heilsgeschichte – eine Abhandlung darüber,
wie wir Menschen einen Graben zwischen uns und Gott aufgerissen haben und wie
Gott über diesen Graben eine Brücke gebaut hat, um die abgebrochene Beziehung
wieder herzustellen. Paulus fängt damit an, dass er von der Schuld des Menschen
spricht, Römer 1 bis 3. Worin bestand die Ursünde? Kap. 1,21: "Trotz
allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die
ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig." Es ist der Bruch des
ersten Gebots: "Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen
Götter neben mir haben!" Es ist der Abbruch der Beziehung mit dem, der
unser Leben gemacht hat und es erhält. Alles andere – der Bruch der übrigen
Gebote, die Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen – folgt dann
daraus. Die Ursünde ist religiös, nicht moralisch. Und worin besteht
folgerichtig eine echte Lebensumkehr? Nicht in moralisch hochstehenden Handlungen,
sondern in der Wiederaufnahme der Beziehung zu Gott, und die zeigt sich eben
nirgends deutlicher als am Gebet. Alles andere – z. B. eine bessere Lebensführung
– wird dann die Frucht davon sein.
Beten heißt: die Beziehung zu Gott pflegen
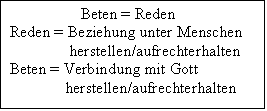 Was spielt sich denn nun eigentlich ab, wenn
wir beten? Sehen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Beten heißt zunächst
einfach Reden, Reden mit Gott. Worum geht es, wenn zwei Menschen miteinander
reden? Die landläufige Auffassung ist die, dass es dabei um bestimmte Inhalte
geht. Der eine teilt dem anderen etwas mit, gibt eine Information weiter: „Hast
du schon gehört – in England ist es gelungen, Hühner zu züchten, die würfelförmige
Eier legen!“ Der andere reagiert darauf, positiv oder (in diesem Fall) vielleicht
auch ablehnend: „So ein Mist. Da muss mich mir ja neue Eierbecher anschaffen!“ (War
natürlich nur ein verspäteter Aprilscherz.) Also: Etwas sagen heißt, eine
Mitteilung machen. Oft stimmt das. Aber es gibt noch einen anderen, einen
tieferen Grund, warum wir miteinander reden. Es geht primär gar nicht immer um
bestimmte Inhalte; es geht ganz einfach darum, eine Verbindung herzustellen
bzw. die zustandegekommene Verbindung sicherzustellen. Es geht darum, soziale
Kontakte aufzubauen, soziale Distanz abzubauen. Mal angenommen, ich bin ganz
allein zu Fuß unterwegs und muss durch ein dunkles Stück Wald. Plötzlich taucht
aus dem Dämmerlicht eine Gestalt auf und kommt auf mich zu. Herzklopfen.
Schweißausbruch. Panik. Soll ich umdrehen und weglaufen? Soll ich die Fäuste in
den Hosentaschen ballen, um notfalls blitzschnell zuschlagen zu können? Es gibt
noch eine dritte Möglichkeit, eine bessere: Ich spreche den Fremden an. „Hallo,
auch noch unterwegs!? Wo soll’s denn hingehen? Ist es noch weit, bis der Wald
zu Ende ist? Also dann, kommen Sie gut an Ihr Ziel! Wiedersehn!“ Merken Sie?
Das, worüber wir reden, ist völlig belanglos. Mich interessiert nicht, woher
der Fremde kommt und wohin er geht. Aber indem wir miteinander reden, schaffen
wir eine Art Nähe, eine Offenheit. Wir stellen gegenseitig sicher, dass wir
normal miteinander umgehen wollen und nicht (wie ein Verbrecher) außerhalb der
menschlichen Gemeinschaft stehen. Indem ich mit dem Fremden rede, wird er mir
vertraut. Jemand, der so nett mit mir redet, mag zwar aus einem finsteren Wald
kommen, aber er ist sicher kein finsterer Geselle mit finsteren Absichten.
Was spielt sich denn nun eigentlich ab, wenn
wir beten? Sehen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Beten heißt zunächst
einfach Reden, Reden mit Gott. Worum geht es, wenn zwei Menschen miteinander
reden? Die landläufige Auffassung ist die, dass es dabei um bestimmte Inhalte
geht. Der eine teilt dem anderen etwas mit, gibt eine Information weiter: „Hast
du schon gehört – in England ist es gelungen, Hühner zu züchten, die würfelförmige
Eier legen!“ Der andere reagiert darauf, positiv oder (in diesem Fall) vielleicht
auch ablehnend: „So ein Mist. Da muss mich mir ja neue Eierbecher anschaffen!“ (War
natürlich nur ein verspäteter Aprilscherz.) Also: Etwas sagen heißt, eine
Mitteilung machen. Oft stimmt das. Aber es gibt noch einen anderen, einen
tieferen Grund, warum wir miteinander reden. Es geht primär gar nicht immer um
bestimmte Inhalte; es geht ganz einfach darum, eine Verbindung herzustellen
bzw. die zustandegekommene Verbindung sicherzustellen. Es geht darum, soziale
Kontakte aufzubauen, soziale Distanz abzubauen. Mal angenommen, ich bin ganz
allein zu Fuß unterwegs und muss durch ein dunkles Stück Wald. Plötzlich taucht
aus dem Dämmerlicht eine Gestalt auf und kommt auf mich zu. Herzklopfen.
Schweißausbruch. Panik. Soll ich umdrehen und weglaufen? Soll ich die Fäuste in
den Hosentaschen ballen, um notfalls blitzschnell zuschlagen zu können? Es gibt
noch eine dritte Möglichkeit, eine bessere: Ich spreche den Fremden an. „Hallo,
auch noch unterwegs!? Wo soll’s denn hingehen? Ist es noch weit, bis der Wald
zu Ende ist? Also dann, kommen Sie gut an Ihr Ziel! Wiedersehn!“ Merken Sie?
Das, worüber wir reden, ist völlig belanglos. Mich interessiert nicht, woher
der Fremde kommt und wohin er geht. Aber indem wir miteinander reden, schaffen
wir eine Art Nähe, eine Offenheit. Wir stellen gegenseitig sicher, dass wir
normal miteinander umgehen wollen und nicht (wie ein Verbrecher) außerhalb der
menschlichen Gemeinschaft stehen. Indem ich mit dem Fremden rede, wird er mir
vertraut. Jemand, der so nett mit mir redet, mag zwar aus einem finsteren Wald
kommen, aber er ist sicher kein finsterer Geselle mit finsteren Absichten.
Das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen antun kann, ist, nicht mehr mit ihm zu reden. (Ich habe das am eigenen Leib erlebt und erlitten, über Wochen und Monate hin.) Schweigen als Bestrafung. Schweigen als Abbruch der sozialen Beziehung. Schweigen als Ausdruck des zerstörten Friedens. Es gibt kaum etwas Hässlicheres, als wenn von zwei Menschen, die sich einmal sehr nahe standen, gesagt wird: „Sie reden nicht mehr miteinander.“ „Sie haben sich nichts mehr zu sagen.“
In unserer Familie wird unheimlich viel geredet. Manchmal bringt eins unserer Kinder einen Kollegen von der Schule oder der Uni zum Essen mit nach Hause. Wenn der Gast dann unsere Tischgespräche miterlebt, haut es ihn jedesmal beinahe vom Hocker: Bei Euch ist es ja soo interessant; Ihr redet über so vieles! Es kommt auch vor, dass eins unserer Kinder woanders zu Mittag isst. Und nachher erzählt es davon: Stellt euch vor – bei denen wurde kein Wort geredet! Die saßen soo stumm am Tisch, dass mir fast unheimlich wurde. Wie halten die das bloß aus? Ich glaub, die haben kurz vorher Krach miteinander gehabt!
Reden als Ausdruck der Verbundenheit. Das ist unter uns Menschen so, aber das ist – genau entsprechend – auch gegenüber Gott so. Indem wir beten, pflegen wir die Beziehung zu ihm. Wenn wir nicht beten, verschließen wir uns vor ihm. Deshalb ist das Gebet tatsächlich das Kennzeichen eines Christen.
Die Geschichte des Gebets: Bitten und Danken
Also: Beten dient – wie alles Reden – dazu, einen Kontakt herzustellen bzw. einen Kontakt aufrechtzuerhalten. Das ist so ganz unabhängig davon, worüber man im einzelnen redet. Gehen wir einen Schritt weiter, fragen wir jetzt nach dem Inhalt des Gebets. Was tun Sie ganz konkret, wenn Sie beten? Es sind in den allermeisten Fällen zwei Dinge: Sie bitten Gott um etwas, oder sie danken Gott für etwas. Das sind die beiden Vorgänge, die das Beten kennzeichnen: Bitte und Dank.
Man könnte auch sagen: Jedes Gebet hat seine ganz persönliche Geschichte. Es fängt mit dem Bitten an und schließt mit dem Danken ab. Sehen wir uns diese Geschichte mal etwas genauer an.
a) Am Anfang: die Bitte
Es beginnt, habe ich gerade gesagt, mit einer Bitte. Eigentlich beginnt es noch vor der Bitte. Nicht jeder wendet sich mit seinen Anliegen an Gott. Damit jemand das tut, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Wer Gott um etwas bittet, bei dem ist dreierlei passiert.
Drei Voraussetzungen
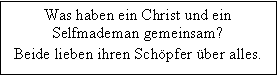 Erstens:
Er hat begriffen, dass er alleine nicht zurecht kommt, sondern auf andere angewiesen
ist. Er hat sich seine Armut eingestanden, seine Hilflosigkeit, seine Schwäche.
Er hat aufgehört, den starken Maxe zu markieren, und hat akzeptiert, dass er nicht
die nötige Kraft, die nötige Weisheit, die nötige Liebe hat, um in den
schwierigen Situationen des Lebens zu bestehen. Er hat die Illusion begraben,
selbständig und unabhängig durchs Leben gehen zu können. Er sieht seine Hände
an und ist ehrlich genug, zuzugeben, dass sie leer sind. Wer meint, seine Hände
sind voll, der wird doch nicht zu einem anderen gehen und ihn um etwas bitten!
Wer sich stark vorkommt und klug und barmherzig, der trinkt aus seiner eigenen
Quelle. Er braucht keine Hilfe von außen. Er ist ein Selfmademan. Wissen Sie,
was ein Christ und ein Selfmademan gemeinsam haben? Beide lieben ihren Schöpfer
über alles! Aber genau das ist es natürlich auch, was sie trennt. Der Christ
weiß, dass sein Schöpfer der wahre und lebendige Gott ist. Der Selfmademan
dagegen hat sich, wie das Wort sagt, selber gemacht, er ist sein eigener
Schöpfer, und den bewundert und verehrt er. Auf Gott kann er locker verzichten.
Aber wer einsieht, dass es ihm an allen Ecken und Enden an grundlegenden Dingen
fehlt, der wird bereit, sich an seinen eigentlichen Schöpfer zu wenden; er wird
Gott um Hilfe bitten.
Erstens:
Er hat begriffen, dass er alleine nicht zurecht kommt, sondern auf andere angewiesen
ist. Er hat sich seine Armut eingestanden, seine Hilflosigkeit, seine Schwäche.
Er hat aufgehört, den starken Maxe zu markieren, und hat akzeptiert, dass er nicht
die nötige Kraft, die nötige Weisheit, die nötige Liebe hat, um in den
schwierigen Situationen des Lebens zu bestehen. Er hat die Illusion begraben,
selbständig und unabhängig durchs Leben gehen zu können. Er sieht seine Hände
an und ist ehrlich genug, zuzugeben, dass sie leer sind. Wer meint, seine Hände
sind voll, der wird doch nicht zu einem anderen gehen und ihn um etwas bitten!
Wer sich stark vorkommt und klug und barmherzig, der trinkt aus seiner eigenen
Quelle. Er braucht keine Hilfe von außen. Er ist ein Selfmademan. Wissen Sie,
was ein Christ und ein Selfmademan gemeinsam haben? Beide lieben ihren Schöpfer
über alles! Aber genau das ist es natürlich auch, was sie trennt. Der Christ
weiß, dass sein Schöpfer der wahre und lebendige Gott ist. Der Selfmademan
dagegen hat sich, wie das Wort sagt, selber gemacht, er ist sein eigener
Schöpfer, und den bewundert und verehrt er. Auf Gott kann er locker verzichten.
Aber wer einsieht, dass es ihm an allen Ecken und Enden an grundlegenden Dingen
fehlt, der wird bereit, sich an seinen eigentlichen Schöpfer zu wenden; er wird
Gott um Hilfe bitten.
Zweitens: Wer Gott um etwas bittet, ist bereit, sich helfen zu lassen. Soo selbstverständlich ist das keineswegs. Nicht jeder, der merkt, dass er auf dem Holzweg ist, macht kehrt. Nicht jeder, der feststellt, dass seine Taschen leer sind, ist bereit, sie sich von jemand anders füllen zu lassen. Es genügt nicht, seine Hilflosigkeit zu begreifen; man muss auch seinen Stolz an den Nagel hängen. Man darf die leeren Hände nicht in der Tasche verstecken, sondern muss sie hervorholen und dem anderen hinstrecken – leer wie sie sind. Wer sich im Gebet an Gott wendet, signalisiert damit seine Bereitschaft, sich helfen zu lassen.
Drittens: Wer Gott um etwas bittet, gibt damit zu verstehen, dass er von Gottes Größe und Macht überzeugt ist, von Gottes Reichtum und Liebe. Wer Geld braucht, wird sich nicht an einen Bettler wenden, sondern an einen Fabrikbesitzer. Wer sich an Gott wendet, rechnet damit, dass Gott ihm die leeren Hände füllen kann und füllen will. Gott kann sie füllen, weil er unendlich reich ist. Gott will sie füllen, weil er uns unendlich lieb hat. Gott hat die Möglichkeit, uns zu helfen, und er hat die Bereitschaft, uns zu helfen.
Das sind also die drei Voraussetzungen dafür, dass jemand sich mit einer Bitte an Gott wendet:
Wer bittet
- weiß, dass er allein nicht zurecht kommt
- ist bereit, sich helfen zu lassen
- ist überzeugt, dass Gott helfen kann und helfen will
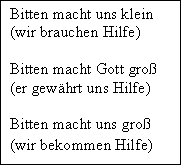 Es gibt wohl kaum etwas, was unser Stellung
gegenüber Gott besser zum Ausdruck bringt als das bittende Gebet. Zunächst stehen
wir mit leeren Händen da. So sind wir: Wir können nicht aus eigener Kraft ein sinnvolles
Leben führen. Nun strecken wir diese Hände Gott entgegen. Damit zeigen wir
Gott, dass wir ihn als Gott erkannt haben. Wir vertrauen darauf, dass er uns
die Hände füllt. Und schließlich erweist sich Gott als Gott und gibt uns alles,
was wir brauchen – großzügig und liebevoll. Unser Bitten macht uns ganz klein:
Wir brauchen Hilfe. Unser Bitten macht Gott ganz groß: Er gewährt uns Hilfe. Und
dadurch macht unser Bitten am Ende auch uns ganz groß: Wir bekommen Hilfe. Gott
tut uns Gutes. Er holt uns an seine Seite. Er behandelt uns wie Menschen, die
seine Nähe verdient haben.
Es gibt wohl kaum etwas, was unser Stellung
gegenüber Gott besser zum Ausdruck bringt als das bittende Gebet. Zunächst stehen
wir mit leeren Händen da. So sind wir: Wir können nicht aus eigener Kraft ein sinnvolles
Leben führen. Nun strecken wir diese Hände Gott entgegen. Damit zeigen wir
Gott, dass wir ihn als Gott erkannt haben. Wir vertrauen darauf, dass er uns
die Hände füllt. Und schließlich erweist sich Gott als Gott und gibt uns alles,
was wir brauchen – großzügig und liebevoll. Unser Bitten macht uns ganz klein:
Wir brauchen Hilfe. Unser Bitten macht Gott ganz groß: Er gewährt uns Hilfe. Und
dadurch macht unser Bitten am Ende auch uns ganz groß: Wir bekommen Hilfe. Gott
tut uns Gutes. Er holt uns an seine Seite. Er behandelt uns wie Menschen, die
seine Nähe verdient haben.
b) Am Ende: der Dank
Die Geschichte des Gebets fängt mit dem Bitten an, und sie schließt mit dem Danken. Der Dank ist das i-Tüpfelchen. Indem wir danken, bekennen wir, dass wir uns in Gott nicht getäuscht haben, sondern dass er wirklich der große Helfer ist. Alles Beten soll letztlich in Dank münden.
„Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.“ Epheser 5,20
„Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn.“ Philipper 4,6
„Dankt Gott in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat.“ 1. Thessalonicher 5,18
Fällt Ihnen an diesen drei Versen etwas auf? Es handelt sich um Befehle! Der Dank wird uns nicht nur empfohlen, er wird uns befohlen. Merkwürdig. Versteht sich Danken denn nicht von selbst? Wenn man was Tolles geschenkt bekommen hat, dankt man dann nicht ganz automatisch? Offensichtlich nicht! Ein älterer Christ sagte mir einmal, als ich ihn besuchte: „Wissen Sie, was mich schmerzt? Da unterstütze ich schon lange Zeit eine ganze Reihe Missionare, und kaum einmal äußert sich jemand dankbar dafür. Ist das denn alles selbstverständlich? Meinem Neffen, der auch in der Mission ist, schicke ich seit vielen Jahren monatlich Geld. Meinen Sie, der hätte sich auch nur ein einziges Mal dafür bedankt? Jetzt ist er zu Besuch bei mir gewesen. Aber von der Unterstützung – kein Wort! So was tut weh.“
Danken fällt
schwer. Die Bibel muss uns zum Danken regelrecht auffordern. Denken Sie an die
Geschichte, die ich zu Beginn vorgelesen habe – die Heilung der zehn
Aussätzigen durch Jesus. Zehnmal Aussatz, zehnmal eine schreckliche,
entstellende Hautkrankheit, zehnmal Ausgestoßensein aus der menschlichen
Gesellschaft, zehnmal Leben in weiter Entfernung von allen Familienangehörigen
und Freunden. Was für ein elendes, hoffnungsloses Dasein! Und dann kommt Jesus.
Das ist ihre Chance: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“ Die Bitte. Die
leeren Hände. Jesus schickt sie zu den Priestern: „Geht und zeigt euch ihnen!“
Die Priester waren so etwas wie die Gesundheitsbehörde. Wenn ein Aussätziger
wieder gesund wurde, durfte er nicht sofort in sein Dorf oder seine Stadt
zurück; erst 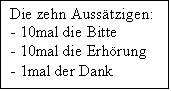 musste der zuständige Priester ihn
untersuchen und die Heilung bestätigen. Die Zehn machen sich auf den Weg. Als
sie losgehen, sind sie noch krank. Als sie ankommen, sind sie gesund! Dem
Priester bleibt nur noch, die Heilung zu konstatieren. Was für ein Wunder! Was
für eine Befreiung! Kein von der Krankheit zerfressener Körper mehr. Wieder
nach Hause dürfen zu Frau und Kindern, zu Freunden und Verwandten! Die Erhörung.
Die gefüllten Hände. Wenn das kein Grund zum Danken ist! Zehn Männer
kommen zu Jesus zurückgerannt, werfen sich vor ihm zu Boden, jubeln und danken.
Wirklich zehn? Einer kommt zurück, ein einziger – und ausgerechnet der
Fremde, der Samaritaner. 10 Prozent Dank, 90 Prozent Undank. „Sind denn nicht
alle zehn gesund geworden?“ sagt Jesus. „Wo sind die anderen neun? Ist es
keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die
Ehre zu geben?“
musste der zuständige Priester ihn
untersuchen und die Heilung bestätigen. Die Zehn machen sich auf den Weg. Als
sie losgehen, sind sie noch krank. Als sie ankommen, sind sie gesund! Dem
Priester bleibt nur noch, die Heilung zu konstatieren. Was für ein Wunder! Was
für eine Befreiung! Kein von der Krankheit zerfressener Körper mehr. Wieder
nach Hause dürfen zu Frau und Kindern, zu Freunden und Verwandten! Die Erhörung.
Die gefüllten Hände. Wenn das kein Grund zum Danken ist! Zehn Männer
kommen zu Jesus zurückgerannt, werfen sich vor ihm zu Boden, jubeln und danken.
Wirklich zehn? Einer kommt zurück, ein einziger – und ausgerechnet der
Fremde, der Samaritaner. 10 Prozent Dank, 90 Prozent Undank. „Sind denn nicht
alle zehn gesund geworden?“ sagt Jesus. „Wo sind die anderen neun? Ist es
keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die
Ehre zu geben?“
Warum fällt uns das Danken nur so schwer? Hat es mit Vergesslichkeit zu tun? Hat es mit Stolz zu tun? Ich erinnere mich an ein kleines Erlebnis aus meiner Studentenzeit. Ich wohnte damals mit einigen anderen Kommilitionen zusammen in einer WG. Vor mir stand ein Prüfungstermin, eine schwierige und wichtige Prüfung. Wir beteten zusammen, dass Gott mir helfen möge, das Examen zu bestehen. Dann kam die Prüfung, und ich bestand sie – noch dazu mit ziemlich guten Noten. Ich radelte in meine WG zurück – total erleichtert und glücklich und wohl auch ein bisschen stolz, ein bisschen zu stolz. „Wie ist es dir ergangen?“ wollten die anderen wissen, und ich berichtete. Und dann sagte einer: „Komm, wir wollen Jesus danken, dass er dir so geholfen hat!“ Ich spüre heute noch den kleinen Stich, den mir das gab. Warum gratuliert er mir denn nicht, wie sich das gehört? Warum verliert er nicht ein einziges Wort über meine tolle Leistung? Warum klopft er mir nicht wenigstens anerkennend auf die Schulter? Statt dessen sagt er: Kommt, wir wollen Jesus auf die Schulter klopfen! Und ich weiß noch, wie es mir im selben Moment wie Schuppen von den Augen fiel: Er hat ja so was von recht! Im Vorfeld der Prüfung haben wir Jesus gemeinsam um seine Hilfe gebeten. Also war es Jesus, der mich bestehen ließ. Also ist es mehr als angebracht, wenn wir uns jetzt gemeinsam bei Jesus bedanken!
„Was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken?“ 1. Korinther 4,7
Zwei Auswirkungen
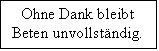 Vielleicht denken Sie: Was macht das schon,
wenn man das Danken unterlässt! Okay, es wäre anständiger, ein Feedback für das
schöne Geschenk zu geben, aber Hauptsache ist doch, man hat das Geschenk. Okay,
die Neun hätten sich noch korrekter verhalten, wenn sie – wie der Samaritaner –
ihrem Wohltäter persönlich gedankt hätten, aber geheilt sind alle zehn, und das
ist doch entscheidend. Der Dank (bzw. der Undank) ändert daran nichts. O doch!
Der Dank ändert sehr viel. Danken ist nicht nur ein hübsches Anhängsel an
unsere Gebetsgeschichte; Danken gehört elementar dazu. Erst das Danken vollendet
den Prozess, weil durchs Danken noch einmal was ganz Neues in unser Leben
kommt. Dieses Neue, dieser zusätzliche Gewinn hat mit unserem Verhältnis zur Gabe
zu tun und mit unserem Verhältnis zum Geber.
Vielleicht denken Sie: Was macht das schon,
wenn man das Danken unterlässt! Okay, es wäre anständiger, ein Feedback für das
schöne Geschenk zu geben, aber Hauptsache ist doch, man hat das Geschenk. Okay,
die Neun hätten sich noch korrekter verhalten, wenn sie – wie der Samaritaner –
ihrem Wohltäter persönlich gedankt hätten, aber geheilt sind alle zehn, und das
ist doch entscheidend. Der Dank (bzw. der Undank) ändert daran nichts. O doch!
Der Dank ändert sehr viel. Danken ist nicht nur ein hübsches Anhängsel an
unsere Gebetsgeschichte; Danken gehört elementar dazu. Erst das Danken vollendet
den Prozess, weil durchs Danken noch einmal was ganz Neues in unser Leben
kommt. Dieses Neue, dieser zusätzliche Gewinn hat mit unserem Verhältnis zur Gabe
zu tun und mit unserem Verhältnis zum Geber.
Erstens: Dank ändert unser Verhältnis zum
Geber.
Durchs Danken entsteht überhaupt erst eine dauerhafte persönliche Beziehung. Die vollständige Gebetsgeschichte vollzieht sich in einem Dreischritt: Bitten – Empfangen – Danken. Wenn ich beim Empfangen stoppe, bleibe ich sozusagen an der Gabe hängen. Ich habe bekommen, was ich bekommen wollte. Gott hat getan, was er tun sollte. Jetzt kann er gehen. Ich bin so auf die Gabe fixiert (vielleicht vor lauter Begeisterung), dass mir der Geber aus dem Blickfeld gerät. Sobald ich aber darüber nachdenke, woher die Gabe denn gekommen ist, blicke ich auf und sehe den Geber vor mir. Das Denken führt zum Danken. Ich lasse die Gabe liegen, geh zum Geber und sag ihm, wie sehr ich mich über seine Großzügigkeit und Liebe freue. Und wissen Sie, was passiert? Den Geber freut meine Dankbarkeit so sehr, dass er mir gerade nochmal ein Geschenk macht. Alle zehn Aussätzigen haben bekommen, worum sie baten: Sie sind geheilt. Neun haben sich den Dank gespart. Einer ist zurückgekommen. Und hören Sie mal, was Jesus zu diesem einen sagt, der da zu seinen Füßen liegt und ihm dankt: „Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat dich gerettet.“ Die Neun sind geheilt, der zehnte ist geheilt und gerettet! Heilung ist gut; Rettung ist noch viel besser. Heilung ist für dieses Leben wichtig; Rettung ist auch für das Leben nach diesem Leben wichtig. Heilung bedeutet: Die Entstellungen des Körpers sind beseitigt. Rettung bedeutet: Die Entstellungen der Seele sind beseitigt, die Sünden sind vergeben, die Last der Schuld muss nicht mehr getragen werden. Heilung bedeutet: Das Äußere ist wiederhergestellt. Rettung bedeutet: Das Innere ist wiederhergestellt. Wenn man sich das überlegt, wird es einem fast unheimlich: Das Beste haben die Neun verpasst! Wegen ihrer Undankbarkeit. Weil sie nicht zu Jesus zurückkamen. Dank verbindet mit dem Geber. Und mit Gott verbunden sein heißt gerettet sein. Dank verbindet mit dem Geber. Und Gott ist so reich und gibt so gern, dass wir bei ihm immer noch was dazubekommen. Paulus drückt das einmal so aus: „Gott vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können.“ Epheser 3,20.
Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Christen mitten in einer Notlage danken können. Sie wissen, dass Gott bei ihnen ist, der unendlich reiche Geber. Einmal sollte Jesus einer Volksmenge von vielleicht zehn- bis fünfzehntausend Leuten zu Essen geben, und er hatte nur 5 Brote und 2 Fische. Jesus steckte total in der Klemme! Eigentlich hätte er jetzt zu Gott um Hilfe schreien müssen: „Was soll ich bloß tun? Die paar Brote reichen nirgends hin! Greif mir unter die Arme, Herr!“ Aber was machte Jesus? Er nahm das bisschen Brot und das bisschen Fisch und dankte Gott dafür. Jesus sah nicht auf die Gabe, er sah auf den Geber, und dieser Geber war sein Vater. Er kannte ihn und wusste: Meinem Vater steht alles Brot dieser Welt zur Verfügung. Er hat Vorratskammern und Kühlschränke, gegenüber denen könnte man alle Vorratskammern und Kühlschränke dieser Erde in einem Fingerhut unterbringen. Er kann mir jederzeit helfen. Ich dank ihm schon mal im voraus dafür. Statt Panik und Verzweiflung: Ruhe und Gelassenheit.
Noch mehr in der Klemme steckte Jesus am Grab von Lazarus. Jesus hätte seinen schwerkranken Freund gesund machen sollen, aber er war zu spät gekommen. Jetzt lag der Leichnam schon 4 Tage im Grab! Und was macht Jesus? Stimmt er in das Jammern und Klagen der Umstehenden ein? Er lässt den Stein vom Eingang wegrollen, richtet den Blick zum Himmel und sagt: „Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst.“ (Johannes 11,41.42) Gottes Macht kann niemand begrenzen, auch nicht der Tod. Jesus weiß das, und deshalb nimmt er den Dank für das Auferweckungswunder vorweg.
Die ersten Christen haben es Jesus nachgemacht. Als Paulus und Silas mitten in der Nacht völlig zu Unrecht im Gefängnis von Philippi saßen – was taten sie in dieser extremen Notsituation? Sie priesen Gott mit Lobliedern! (Apostelgeschichte 16,25) Und daraufhin griff Gott auf spektakuläre Weise ein und befreite sie! Als Paulus zusammen mit einigen Freunden auf einer Schiffsreise in einen fürchterlichen Seesturm geriet und kein Kapitän, kein Offizier und kein Matrose mehr einen Pfifferling auf ihr Leben gab – was tat er in dieser Todesgefahr? Er griff nach einem Brotlaib, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Und durch sein Beispiel bekamen auch alle anderen neuen Mut und stärkten sich ebenfalls. (Apostelgeschichte 27,35.36)
Jedesmal scheint der normale Ablauf auf dem Kopf zu stehen; die Gebetsgeschichte macht sozusagen einen Salto rückwärts. Erwarten würden wir zuerst die Bitte und hinterher den Dank. Aber jedesmal kommt hier der Dank schon vor der Erhörung. Die Gabe ist noch gar nicht da – aber der Geber ist da! Und das ist Grund genug, dankbar zu sein.
Zweitens: Dank ändert unser Verhältnis zur
Gabe.
Zur Zeit übersetze ich den Epheserbrief. Im 5. Kapitel bin ich an einer Aussage hängengeblieben, die auf den ersten Blick ziemlich unlogisch daherkommt. Paulus gibt im zweiten Teil des Epheserbriefs eine Vielzahl praktischer Tips für eine christliche Lebensgestaltung. So beschreibt er z. B., wie wir mit der Sexualität umgehen sollen:
„Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Geldgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen; sich damit zu beschäftigen schickt sich nicht für Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Genauso wenig haben Obszönitäten, törichtes Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch verloren. Was hingegen eure Gespräche prägen soll, ist Dankbarkeit gegenüber Gott.“ Epheser 5,3.4
Im letzten Satz dieses Zitats stoßen wir auf unser Stichwort: Dankbarkeit. Aber irgendwie scheint dieses Stichwort hier fehl am Platz zu sein. Paulus kämpft gegen den Missbrauch der Sexualität. Er sagt nicht nur, was verkehrt ist, sondern gibt uns auch ein Gegenmittel zur Hand, ein Korrektiv sozusagen. Wie kann man den Missbrauch korrigieren? Durch Anständigkeit, würden wir sagen, durch Reinheit, durch Treue. Paulus sagt: durch Dankbarkeit. Das kommt echt überraschend. Aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, merkt man: Was auf den ersten Blick wie voll daneben wirkt, trifft in Wirklichkeit voll ins Schwarze.
Du hast mit sexueller Unmoral zu kämpfen? sagt Paulus. Dann sei statt dessen dankbar. Dankbar wofür? Für die Sexualität. Danke Gott für die Sexualität. Sie ist seine Erfindung. Sie ist sein Geschenk. Indem ich für die Sexualität danke, sehe ich sie als das, was sie ist: eine gute Gabe Gottes. Aber gleichzeitig wird durchs Danken noch etwas anderes klar: Sexualität ist nur dann eine Bereicherung, wenn ich sie bewusst von Gott entgegennehme, mit anderen Worten: wenn ich nach seinen Spielregeln damit umgehe. Sobald ich sie von Gottes Idee löse, entpuppt sich die Sexualität als kontraproduktiv, entfaltet ein Suchtpotential, zerstört Beziehungen. Sexualität ohne Dankbarkeit stellt die Gabe ins Zentrum, und das ist gefährlich. Das kann bis dahin führen, dass mein Denken und Handeln total beschlagnahmt werden. Hingegen wenn ich Gott für die Sexualität danke, stelle ich den Geber ins Zentrum, und auf diese Weise rückt alles ins Lot, bekommt alles den ihm angemessenen Stellenwert. Paulus greift also keineswegs daneben, wenn er die Dankbarkeit als Heilmittel aus dem Arzneischränckchen holt. Im Gegenteil, seine Wahl zeugt von tiefer Einsicht und tiefer Weisheit. Dankbarkeit ist genau die richtige Medizin bei fehlgeleiteter Sexualität. Und natürlich genauso auch bei jedem anderen Missbrauch von Gottes guten Gaben.
***
So, jetzt haben wir ausführlich über die Geschichte des Gebets nachgedacht, über den Dreischritt von Bitten, Empfangen und Danken. Gebet ist das Kennzeichen des Christen, sagte ich zu Anfang. Nach all dem, was wir uns jetzt überlegt haben, müssten wir es eigentlich noch präziser formulieren: Das Kennzeichen des Christen ist Danken. Erst wenn jemand Gott dankt, ist der Kreis geschlossen, das Ziel der Gebets-Geschichte erreicht, die persönliche Verbindung mit Gott sichergestellt.
Ein Mustergebet als Gebetsmuster: „Abba,
Vater!“
Zum Schluss möchte ich nochmals ganz kurz auf den Vers aus Römer 8 zurückkommen, den ich zu Beginn der Predigt zitiert habe. Erinnern Sie sich? „Durch Gottes Geist rufen wir, wenn wir beten: ‚Abba, Vater!’“ (Römer 8,15) Paulus legt uns hier sozusagen ein Gebetsmuster vor, ein Mustergebet. Er sagt es sehr präzise: "Wir rufen: Abba, Vater!" Daran ist zweierlei interessant – die Form und der Inhalt.
1. Die Form: Wie beten wir?
Wir rufen. Das bedeutet: Unser Gebet ist frei und spontan. Es bricht aus uns heraus. Niemand muss uns dazu zwingen; wir brauchen kein vorformuliertes Gebet, das wir dann ablesen (obwohl das manchmal gar nicht schlecht ist; Gebete von anderen nachbeten kann sehr bereichernd sein). Jesus hat mal gesagt: "Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er" (Matthäus 12,34). Oder, mit der alten Luther-Übersetzung: "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über." Früher war unser Herz erfüllt mit Hass – Hass auf Gott, Hass auf den Nachbarn, Hass auf die Eltern; es war erfüllt mit Stolz, mit Verzweiflung, mit Ängsten und Sorgen. Und immer wieder brach sich das Bahn – in wüsten Flüchen, in gereiztem, bitterem Reden. Jetzt ist das Herz erfüllt mit dem neuen Leben, das der Heilige Geist gebracht hat; es ist erfüllt mit dem Wissen: Ich bin Gottes Kind! Und da muss sich das Herz einfach Luft machen, und es platzt heraus: "Abba, Vater!" Es ist naheliegend, dass Paulus Gottesdienste miterlebt hat, wo die Christen vor Freude und Begeisterung laut zu Gott, ihrem Vater, gerufen haben: "Abba, Vater!"
2. Der Inhalt: Was beten wir?
"Abba, Vater!" Aber Paulus – das ist doch kein vollständiges Gebet! Da fehlt doch die Hauptsache: eine Bitte, ein Dank, eben das, was ein Gebet ausmacht. Wirklich? Ich würde sagen, die Hauptsache ist da, das Entscheidende ist ausgedrückt, die Grundlage für alles Bitten und allen Dank. Dass Gott unser Vater geworden ist, das ist die Zusammenfassung der Erlösung – Gott nicht mehr nur der Schöpfer, der Herr, der Richter, sondern mein Vater. Ich nicht mehr in unendlicher Ferne von ihm, sondern in seinem Haus, aufgenommen in seine Familie. Besser könnte man den phantastischen Wechsel, der durchs Kreuz stattgefunden hat, nicht in Worte fassen. Ein Christ, ein Wort: "Vater".
Der große, allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott Abrahams, der Gott Moses, der Gott Davids, der liebt mich höchstpersönlich so, dass er mich ganz in seiner Nähe haben will. Ich bin in die denkbar engste Verbindung mit ihm gerufen; ich gehöre zu ihm, und er gehört zu mir. Es wird einem fast schwindelig, wenn man sich das vorstellt. Wenn der Präsident der USA aus heiterem Himmel eine Elendsgestalt von den Müllhalden in Manila adoptieren würde – das wäre noch nichts im Vergleich dazu. Die ganze Welt wäre gerührt und neidisch, und das Adoptivkind würde platzen vor Stolz und Glück (falls es überhaupt begreift, was da vor sich geht). Ja, die Bibel möchte, dass wir begreifen, was Gott da mit uns anstellt, und dass wir vor Stolz auf ihn platzen. "Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein" (1. Korinther 1,31).
Gott ist mein Vater: Deshalb habe ich allen Grund, ihm zu danken. Gott ist mein Vater: Deshalb habe ich das Recht, ihn zu bitten. Aus diesem einen Wort folgt tatsächlich alles weitere, konkrete Beten.
3. „Abba“
Nun steht da allerdings noch so ein merkwürdiges kleines Wort dabei: "Abba". Was heißt denn das? Manchen schon etwas älteren Jugendlichen kommt da wahrscheinlich Musik aus Schweden in den Sinn. Aber damit hatte Paulus natürlich nichts am Hut, daran konnte er ja noch gar nicht denken! Die Lösung ist ganz einfach: Abba ist hebräisch-aramäisch und bedeutet "Vater/mein Vater"; es ist die Anredeform. Aber dann ist es ja noch merkwürdiger; dann sagt Paulus ja zweimal dasselbe! "Vater, Vater"! Wozu denn das? Erst das aramäische Wort und dann die griechische Übersetzung? Da könnte Paulus doch gleich nur das Griechische schreiben. Nun, der Grund ist ganz einfach: So hat Jesus selbst gebetet. In Markus 14,36 wird uns berichtet, dass Jesus im Garten Getsemane folgendermaßen betete: "Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst." Jesus sprach aramäisch, er sagte "Abba" (und Markus übersetzt es für seine griechischsprachigen Leser: "Vater"). So hat Jesus es auch seine Jünger gelehrt: "Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel ..." (Matthäus 6,9); und noch kürzer in Lukas. 11,2: "Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater ...". Auch hier hat es Jesus höchstwahrscheinlich die aramäische Form verwendet: "Abba". Die ersten Christen haben diese Anrede Gottes sozusagen im Originalton aufgegriffen – genauso, wie Jesus sie ausgesprochen hat. Daran wird zweierlei deutlich. Zum einen, was für einen Eindruck das Beten Jesu auf sie gemacht hat – es war so vertrauensvoll, so persönlich, so tief empfunden, in so einer engen Beziehung zu dem großen Gott! An diesem Ausdruck, an dieser Art zu beten war ihnen klar geworden: Dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn, Gottes einziger, einzigartiger Sohn. Er kann und darf Vater zu ihm sagen. Und zum anderen wollten sie damit zum Ausdruck bringen: Wir dürfen es genauso machen wie Jesus. Durch den Sohn sind auch wir Söhne geworden. Wir teilen seine Gottesbeziehung.
"Abba" war übrigens ein sehr familiärer Ausdruck, vergleichbar mit unserem "Papa". Viele Juden, die Jesus so beten hörten, werden das als zu wenig ehrerbietig, als aufdringlich empfunden haben: So redet man doch nicht mit dem allmächtigen Gott! Mit Gott auf Du und Du? Nun, wir von Haus aus nicht, aber Jesus sehr wohl, und durch ihn dann auch wir. Und genau deshalb haben die Anhänger Jesu diese Gebetsanrede nachgeahmt. Sie sprachen ganz bewusst so kühn. Das drückte ihre tiefsten Überzeugungen und Empfindungen aus: Wir sind jetzt nicht mehr Sklaven, Befehlsempfänger; wir haben es in unserer Religion jetzt nicht mehr nur mit einem Berg von Gesetzen zu tun. Wir müssen uns nicht mehr abquälen mit dem Versuch, Gott zu gefallen. Nein, Gott hat uns lieb, er ist unser Vater. Wir sind seine Familienmitglieder, wir sitzen an seinem Tisch. "Abba" zeigt, wie sehr die ersten Christen auch emotional bewegt waren, wie tief sie auch gefühlsmäßig ihre neue Beziehung zu Gott erlebten. Der Glaube ist nicht nur etwas für den Kopf, er ist auch was fürs Herz.
Und diese tiefe Beziehung zu Jesus können wir nirgends besser zum Ausdruck bringen, als wenn wir mit ihm über alles reden, was uns bewegt. Wenn wir ihm unsere Ängste sagen, unsere Sorgen, unsere Pläne, unsere Freuden, unseren Dank. Und wenn wir mit ihm über alles reden, was ihn bewegt – seine Pläne, seine Ziele, seine Menschen. Beten, Bitten und Danken: das Kennzeichen der Christen.